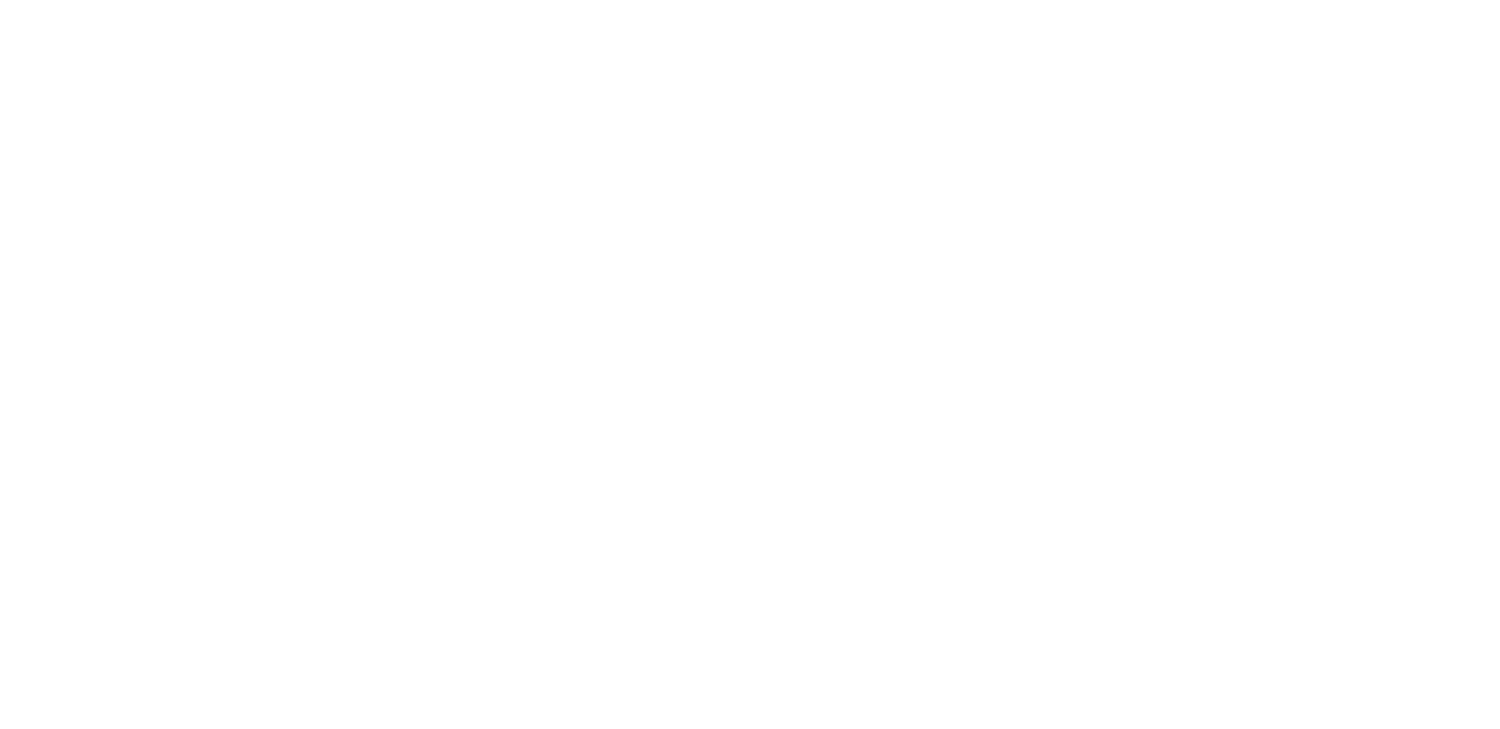Gemeinsam entdecken wir 2025, was die Gewöhnliche Mehlbeere so außergewöhnlich macht!
Baum des Jahres 2025
Die Mehlbeere (Sorbus aria)
Der „Baum des Jahres“ wird vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft zusammen mit dem Kuratorium Wald jedes Jahr neu bestimmt. Damit soll auf eine bedeutende, aber auch gefährdete Baumart aufmerksam gemacht werden. Gleichzeitig will man ein Bewusstsein für den Wald sowohl in seiner Gesamtheit als auch in seiner vielfältigen wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Bedeutung für uns Menschen schaffen.
Im Jahr 2025 ist die Mehlbeere (Sorbus aria) der Baum des Jahres.
Die Echte Mehlbeere gehört zur Familie der Rosengewächse und ist fast überall in Europa verbreitet. Andere Namen sind Mehlbirne oder Silberbaum.
Die Mehlbeere ist ein mittelgroßer, sommergrüner Tiefwurzler, der nur langsam wächst und ca. 10-15 (selten 20) Meter Höhe erreicht. Dafür wird sie bis zu 200 Jahre alt. In geschützten Lagen sind aus Tirol vereinzelt mächtige Exemplare mit über 50 cm Brusthöhendurchmesser bekannt, z.B. im Naturschutzgebiet Kaisergebirge oder in Osttiroler Eichenwäldern.
Als lichtliebende Baumart wächst die Mehlbeere auf offenen, flachgründigen und daher eher trockenen Standorten. Am häufigsten kommt sie auf Kalk und Dolomit, seltener auf nicht zu sauren Silikatgesteinen vor. Sie ist von den Tieflagen bis in die subalpine Höhenstufe verbreitet und kommt in warmen Eichen- und Edellaubwäldern, Trockenhang-Buchen-, Kiefern- und Fichtenwäldern und sogar Latschengebüschen vor.
Markante Merkmale sind ihre mehlig weißen, filzigen Blattunterseiten, von denen sie auch ihren Namen hat. Die elliptische, randlich doppelt gesägte Laubblattspreite ist meist in der Mitte am breitesten, mit jederseits 10 bis 14 Nerven. Die weißen Blüten sind ab Mai in großen, aufrechten Trugdolden zu sehen. Die orangen bis roten Früchte, die ab September in Büscheln reif werden, sind kugelig bis eiförmig (jedenfalls länger als breit) und haben zahlreiche kleine Pünktchen. Sie schmecken fad und mehlig. Auffällige bunte Farben haben auch ihre Blätter im Herbst, die sich von gelb über orange bis knallrot und goldbraun verfärben.
Einheimische Verwandte der Mehlbeere sind die Eberesche oder Vogelbeere (Sorbus aucuparia, mit zwei Unterarten), die Zwergmehlbeere (S. chamaemespilus, ein subalpiner Strauch) und die v.a. im westlichen Nordtirol verbreitete, stark gefährdete Vogesen-Mehlbeere (S. mougeotti). Letztere ist durch weniger Blattnerven (jederseits 8 bis 10), bis zu ¼ der Spreitenhälfte eingeschnittene Blätter und nur wenige Pünktchen auf den Früchten von der Echten Mehlbeere zu unterscheiden.
Die Österreichische Mehlbeere (S. austriaca) ist vermutlich ein Hybrid aus Griechischer Mehlbeere und Vogelbeere, sie kommt nur in Osttirol (und Ostösterreich) vor. In Tirol nicht heimische Arten sind der Speierling (S. domestica) und die Elsbeere (S. torminalis), sie wachsen z.B. in Südtiroler Eichenmischwäldern. In Bayern kommen etwa 40 verschiedene Arten der Gattung Sorbus vor.
MEHLBEERE
Ein Baum mit Zukunft
Die Mehlbeere hat als „Klimabaum“ gute Karten, weil sie einerseits sommerliche Trockenheit und Hitze sehr gut verträgt, aber auch in den Bergen bis zur Waldgrenze bei lichten Waldstrukturen vorkommt. Der Verdunstungsschutz durch den Haarfilz auf der Blattunterseite ist gegen extreme Strahlungsverhältnisse behilflich. Als Pionierbaum kann sie schnell auch die kargsten Standorte mit extrem ungünstigen Wuchsbedingungen besiedeln und spielt daher bei der Sanierung von Schutzwäldern eine wichtige Rolle. So ist sie trotz ihrer geringen Größe waldökologisch ein wahrer Riese und ein bereicherndes Mischelement für strukturreiche Bergwälder. Aufgrund ihrer geringen Konkurrenzkraft braucht sie aber häufig eine waldbauliche Unterstützung; nach Aufforstungen ist es sinnvoll, sie von bedrängenden Konkurrenten zu befreien, um eine vitale Kronenentwicklung zu ermöglichen. Sie wird wegen ihrer schönen Form und Unkompliziertheit auch gerne als Park- oder Straßenbaum in Städten gepflanzt.
Die Mehlbeere ist zur Blütezeit eine wichtige „Bienenweide“ für Insekten. Ihre Früchte werden von unzähligen Vögeln, aber auch von Säugetieren wie Mäusen und Wildarten gefressen. Vom Laub der Mehlbeere leben viele Falterarten (wie Segelfalter, Baum-Weißling und Gelber Hermelin). Für die natürliche Verbreitung des Baumes sorgen Vögel, die die Samen oft mehrere Kilometer vom Samenbaum entfernt unverdaut wieder ausscheiden. Bei Untersuchungen wurden 18 Vogelarten beim Verzehr der Mehlbeeren beobachtet. Forscher konnten bislang 157 pflanzenfressende Insekten- und Milbenarten nachweisen. Davon sind 31 Arten auf die Mehlbeere spezialisiert. Ihr Beitrag zur Artenvielfalt im Wald ist also unschätzbar.
Auch der Mehlbeerbaum ist nicht vor Schädlingen gefeit: er kann durch Mistelbefall oder Pilze wie z.B. Hallimasch, Schüppling-, Porling- oder Trameten-Arten „leiden“ bzw. ihnen Lebensraum bieten. Natürlich dezimiert auch der Verbiß durch Schalenwild mancherorts die Naturverjüngung stark, was gerade in sensiblen Schutzwäldern wie z.B. den inneralpinen Kiefernwäldern ein massives Problem darstellt.
In Notzeiten wurden die getrockneten Früchte zu Mehl verarbeitet und dem Brotmehl beigemischt. Daraus wurde fruchtiges und wohlschmeckendes „Hutzelbrot“ gebacken. Die Beeren können nach einem Frost auch zu Gelee oder Kompott verarbeitet werden. Roh sind sie für den Menschen nicht zu empfehlen.
Mehlbeerholz ist durch das langsame Wachstum eines der härtesten europäischen Hölzer und wird für Drechsel- und Wagnerarbeiten eingesetzt. Früher wurden daraus Zahnräder, Fassdauben und Axtstiele, aber auch Instrumententeile hergestellt.
Vereinigung der Waldaufseher und Forstwarte Tirols (waldaufseher.org) & Manfred Hotter (Tiroler Forstverein)