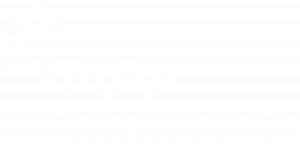Der Tiroler Wald
in Zahlen
Unsere Kampagne
Der Tiroler Wald in Zahlen
Der Tiroler Wald ist mehr als nur ein grünes Band zwischen Bergen – er ist Lebensraum, Schutzschild, Rohstoffquelle, Arbeitsplatz und ein Ort der Erholung.
Über 40 % unseres Landes sind bewaldet, doch was steckt eigentlich alles hinter dieser Zahl?
Wie schnell wächst der Wald?
Wieviel CO₂ bindet er?
Wie viele Tiere leben darin?
Und welche Rolle spielt er im täglichen Leben der Menschen in Tirol?
Mit unserer Kampagne „Der Tiroler Wald in Zahlen“ möchten wir die Vielfalt, Bedeutung und Faszination unseres Waldes auf eine neue, verständliche Weise sichtbar machen – mit Zahlen, Daten und Fakten, die zum Staunen, Nachdenken und Weitererzählen einladen.
Einmal im Monat präsentieren wir auf dieser Seite eine spannende Kennzahl rund um den Tiroler Wald. Mal geht es um Fläche und Wachstum, mal um Klima, Forstwirtschaft oder Biodiversität – kompakt aufbereitet und mit Bezug zu aktuellen Themen.